„Und es ward Licht“ in der „Notkapelle“
Zur Kinogeschichte der Burg-Lichtspiele Gustavsburg | Festvortrag von Professor Dr. Wolfgang Schneider
Fangen wir mal ganz von vorne an: Was ist eigentlich Film? Jean-Luc Godard, französischer Filmemacher der „Nouvelle Vague“, behauptete: „Film ist Wahrheit, 24 mal in der Sekunde“; denn im Kino läuft ein Film mit der Geschwindigkeit von 24 Bildern in der Sekunde durch den Projektor. In Zeiten von Fake News, Desinformationen und dem Kampf der Bilder erscheint der Begriff Wahrheit zumindest hinterfragenswert. Deshalb gleich noch ein anderes Zitat, dieses Mal von Hollywoodregisseur Brian De Palma. Er soll gesagt haben: „Film lügt ununterbrochen, 24 mal in der Sekunde“. Ja, was denn nun? Wahrscheinlich haben beide recht, Film bildet Wahrheiten in Bildern ab, kann Realitäten wahrhaftig dokumentieren und wahre Geschichten audiovisuell erzählen. Und Film hat die Möglichkeiten mit Kamera, Dramaturgie und Schnitt das Publikum zu manipulieren. Willkommen im Filmtheater, willkommen im Haus der Kinokunst, willkommen in den Burg-Lichtspielen zu Gustavsburg.

Es war am 26.3.1947, also genau vor 75 Jahren, dass die Militärregierung Deutschlands mit einer Urkunde Kurt Palm „zwecks Ausübung folgender Tätigkeit“ die Erlaubnis erteilte, nämlich die „Vorführung genehmigter Filme“. Die sogenannte Registrierung der Burg-Lichtspiele erfolgte durch Irvin C. Scarbeck von der Film Section der US Army im Office of Military Government des Landes „Greater Hesse“. Das war die Geburtsstunde des Kinos in der Mainspitze, besser gesagt: die Wiedergeburtsstunde. Denn Kinos gab es auch schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Bischofsheim, Ginsheim und Gustavsburg. Das „Lichtspielhaus“ und die „Saalbau-Lichtspiele“ in Ginsheim sowie die „Adler- Lichtspiele“ und die „Capitol-Lichtspiele“ in Bischofsheim. Und mit der ersten öffentlichen Filmvorführung am 3. April 1947 auch in Gustavsburg.
Mit Mauersteinen von Mainzer Trümmergrundstücken
„Ich war schon als Kind ein Filmnarr“, schreibt Kurt Palm anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Burg-Lichtspielen im Jahre 1997, „dies wussten auch meine Eltern und Verwandten, und so bekam ich an Weihnachten 1932 (...) ein kleines 35mm-Vorführgerät mit Handkurbel und Wochenschau-Ausschnitten geschenkt“. Als Schüler verbrachte der 1924 in Gustavs- burg Geborene seine Freizeit im Kino und wurde „gegen Geld oder Arbeit“ im Kino als Filmvorführer ausgebildet. Als junger Soldat schaffte er es, mehrfach verwundet, als Kameramann für die Kriegsberichterstattung eingesetzt zu werden. Nach der Gefangenschaft kehrte er in seine Heimatgemeinde, mit damals 2500 Einwohnern, zurück und half beim Wiederaufbau. Nicht ganz uneigennützig; denn viele der Rucksäcke und Taschen mit Mauersteinen von Mainzer Trümmergrundstücken, die er über die Eisenbahnbrücke geschleppt hatte, gelangten auch in die ehemalige „Notkapelle“ der Evangelischen Kirchengemeinde an der Darmstädter Straße, die er vom MAN-Werk mieten konnte.
Aus dem Gotteshaus von 1896 wurde nach dem Ersten Weltkrieg eine Kaserne für die französischen Besatzungssoldaten, danach stand es als Turnhalle für die Jugend zur Verfügung und konnte nach dem Zweiten Weltkrieg wegen der Beschlagnahmung der Grundschule durch die Amerikaner als Unterrichtsraum für die ersten Schüler der Nachkriegsgeneration genutzt werden. In diesem Gebäude fanden auch die ersten Wahlen für die Gemeindevertretung im Jahre 1946 statt. Nach Abnahme des Türmchens und dem Umbau der Fassade, mauerte Kurt Palm eigenhändig den feuer- festen Vorführraum und stattete diesen mit zwei alten Kino-Maschinen aus, „die ich in einem ausgebombten Dorf in der französischen Besatzungszone aufgestöbert habe“. Süffisant fügte er vor 25 Jahre hinzu: „Aber Gottseidank gab es damals noch nicht so viele Ämter, die beim Bauen Schwierigkeiten machten.“
Weil alle Lust auf Kino hatten
Freunde und Handwerker, ein pensionierter Schulleiter und Mitarbeiter von MAN packten mit an, weil alle Lust auf Kino hatten. „Keiner hatte damals ein Auto um nach Wiesbaden zu fahren“, notierte der en- gagierte Cineast in seinen Erinnerungen, „wo schon verschiedene Kinos spielten – Mainz kam nicht in Fra- ge, da (...) ein besonderer Passierschein erforderlich war. Außerdem musste man sich stundenlang anstellen, um eine Eintrittskarte für 0,80 Reichsmark zu bekommen.“ Vom Kinomacher, zeitweise gehörten ihm zwei Dut- zend Lichtspielhäuser, entwickelte er sich zum Filmunternehmer, eröffnete ein eigenes Film-Kopierwerk und wurde 1971 mit seiner Firma REPA Deutschlands erfolgreichster Filmproduzent. Zahlreiche Dokumenta- tionen wurden mit Prädikaten ausgezeichnet, Kasse machte er aber mit erotischen Zeichentrickfilmen wie beispielsweise mit „Schneeflittchen und die 7 Zwerge“, mit Sexfilmen wie „Liebestechnik für Fortgeschrittene“ und „Pornografie in Dänemark.
In der Mainzer Allgemeinen vom 24. August 1949 wird unter der Überschrift „Modern und ansprechend“ von den Burg-Lichtspielen „im neuen Gewand“ berichtet. In knapp achtwöchiger Bauzeit habe das Kino ein völlig neues Gesicht erhalten „und ist heute wohl das schönste Filmtheater in der Main- spitze“. Der Zuschauerraum mit seiner Stoffwandbekleidung in elfenbeinweißem Farbton und goldenen Verzierungen verfügte über 280 Plätze. Elektrische Wandkerzen sollte die diskrete Vornehmheit des Rau- mes unterstreichen. Die Decke des Kinos, die früher aus einfachen Balken bestand, war mit Leichtbauplat- ten verkleidet worden, so dass dadurch die Akustik des Theaters wesentlich behoben worden sei. Die Vorhänge auf der Bühne und am Eingang bestanden aus schwerem goldenem Plüsch. Die Bühne selbst sei auch für Variete-Vorführungen geeignet und wurde von einer „Lichtorgel“ farbig angestrahlt. Besonders erwähnenswert fand der Berichterstatter die neue Klimaanlage, die „im Sommer und Winter für eine gute Temperatur“ sorgen soll. Der Lokal-Anzeiger für die Orte der Main- spitze vom 19. August 1949 weiß auch von der fei- erlichen Stimmung mitzuteilen und resümiert: „...al- les fügt sich harmonisch und warm in das Ganze ein“. Nicht unerwähnt bleiben soll auch der Hinweis auf die lokalen Gewerbetreibenden, „die zu dem schönen Gelingen des Umbaues beitrugen“. Die Burg-Lichtspiele seien ein „Schmuckkästchen und die Gustavsburger können stolz darauf sein“.

Der beste Film der Welt zur Wiedereröffnung
Zur Eröffnungsvorstellung im renovierten The- ater am 12. August 1949 um 20.30 Uhr wurden Einladungen gedruckt, jeweils „gültig für 2 Personen“. Heimatforscher und Schullehrer Erich Neliba begrüßte im Namen der Direktion. Seine Festrede beschloss er mit einem Zitat aus Goethes Faust, heißt es im Lokal-Anzeiger „und übergab das Theater der Öffentlichkeit“. Hierauf öffnete sich der Vorhang und auf der Leinwand wurde der Film „Und es ward Licht“, Originalti- tel: „La Symphonie Pastorale“, gezeigt.
Erlauben Sie mir an dieser Stelle ganz kurz einen Exkurs, oder besser gesagt, einen historischen Einschub, um nachzuvollziehen, was ansonsten die Bürger der Mainspitze Ende der gerade entstehenden Bundesrepublik Deutschland beschäftigte. Der „Lokal- Anzeiger“ für die Mainspitze durfte wieder erschei- nen und stellte in mehreren Ausgaben die Frage: „Wer wird Bundespräsident?“ (12.8.1949). Eine Bürgerver- sammlung in Gustavsburg beschloss, nach 15 Jahren Zugehörigkeit zur Stadt Mainz, selbständig zu bleiben. Das Protokoll dokumentiert: „20.15 Uhr Begrü- ßung durch Bürgermeister Reichert im Saalbau Ditt. Gegen 22.45 fand die für hiesige Verhältnisse stark besuchte Veranstaltung ihren Abschluss.“ (25.11.1949) Der Wahlsonntag in Bischofsheim erbrachte für die SPD 2043, die CDU 928, die FDP 755 und die KPD 243 Stimmen. Mit Inseraten warben die Hafen-Sport- Klause, die Textil-Etage, das Lebensmittelhaus Wolters, die Strickstube von Martha Donhauser und der Damen- und Herren-Salon von Friedrich Graf und Sohn in Gustavsburg, Radio-Hohmann an der Kostheimer Mainbrücke und Fritz Engert für Motorräder, Motorroller und Fahrräder der NSU, mit der Möglichkeit einer „Teilzahlung“.
Licht und Schatten, Wahrheiten und Lügen
Zurück zum Film. „Und Gott sprach“, so steht es im ersten Buch Moses, „es werde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis“. „Gut Licht“ heißt es am Filmset und das meint so etwas wie „Waidmanns Heil“ bei den Jägern. Und wir feiern heute die „Lichtspiele“ auf der Burg. Filme bringen es also ans Licht und nicht nur zu Zeiten der Schwarz-Weiß-Filme zeigen sie Licht und Schatten und spielen damit. Wahrheiten werden ans Licht gebracht und Lügen ebenso beleuchtet. Schon seit seiner Erfindung im Jahre 1895 waren Filmvor- führungen ein Faszinosum für das Publikum, sie lie- ßen sich Bilder zeigen und ließen sich auf ihre emotionale Kraft ein. Kinos wurden Orte der Gefühle, vor allem wegen der expressiven Geschichten. Bei Durchsicht der Ankündigungen der Filme, die in den frühen Jahren dieses Hauses gezeigt wurden, wird in den Analysen der Anzeigen deutlich, was Angebot und Nachfrage zum Programm bestimmt hat.
In den vergilbten „Gustavsburger Film-Vorschauen“ von 1949 bis 1951, die im Archiv des Kulturbüros aufbewahrt werden, lassen sich drei Werbestrategien ablesen. Es geht um Filme, die das Dramatische des Gesamtkunstwerks dem Schau-Spiel und der Bild-Einstellungen, der Montage und der Musik betonen: „Eine unheimliche Geschichte, ein rasantes Geschehen, gefühlsstark und packend, Spannung vom Anfang bis zum Ende, eine dramatische Handlung, ein Furioso der Leidenschaften, ein packendes Werk, atemberaubende Szenen, abenteuerliche Situationen, ein beklemmendes Tempo, spannende Verfolgungsjagden, ein erschütternder Reißer. Was sich hier abspielt ist aus dem Leben ge- griffene erregende Lebenswirklichkeit.“

Bild: Erika Palm, Kurt Palm, Professor Dr. Wolfgang Schnei- der und Walter Felder bei der Wiedereröffnung der Burg-Lichtspiele 2011.
Abenteuer, Liebe, Sensation, und Humor
Es geht aber auch um Filme, die das Herz erwär- men sollen: „Ein Streifen voller menschlicher Herzenswärme, eine zarte Liebesgeschichte, eine Ballung, eine hinreißende Revue, ein erschütterndes Liebesdrama, ein unvergleichlicher Sittenfilm. Die Beziehungen der Geschlechter führen zu Glück oder Verhängnis? Wann? Wie? Wo?“ Und es geht um Filme, die vor allem un- terhalten sollen: „Ein Angriff auf die Lachmuskeln, alles jauchzt vor Schadenfreude, ein köstliches Lustspiel, eine Liebeskomödie der Irrungen mit Schwung und Tempo, ein Triumph des Witzes, unwiderstehliche Heiterkeit. Nach diesem Filmlustspiel haben Sie eine Laune wie nach einem teuer erkauften Schwips. Bauschige Röcke wippen, bunte Uniformen glänzen, Musik und Schwung, Heiterkeit und Verliebtheit in der guten alten Zeit, ein beschwingtes Lustspiel voll Frohsinn und Herzlichkeit.“ Letztlich geht es bei allem um Emotio- nen, wie die Ankündigung des „Spätfilms“ „Die Nacht der Sensationen“ mit Harry Piel, der von Freitag, 6. bis Sonntag 8. Juli 1951 gezeigt wurde, es zusammenfasst: „In diesem Film ist alles enthalten: Abenteuer, Liebe, Sensation, und Humor.“

Harry Piel steht wie kaum ein anderer Darsteller für die Stars des Kinos der Nachkriegszeit, ebenso wie Maria Schell und O. W. Fischer, Sonja Ziemann und Rudolf Prack oder Ruth Leuwerik und Theo Lingen. Sie waren einerseits die Zugpferde für die Filme, sie galten andererseits aber auch als Identifikationsfiguren des Publikums, die ihre besonderen Eigenschaften in den Rollen, die sie spielten, zu schätzen wussten. Viele von ihnen waren auch schon in der Zeit des Nationalsozialismus im Kino zu sehen. Auch hier war von einer „Stunde Null“, also einem Neuanfang in der Ge- sellschaft, nichts zu spüren – ebenso wie im System der Polizei und Justiz, der Schule und später dem Militär. Der Film im sogenannten „Dritten Reich“ war ein Pro- pagandamittel, das auf perfide Art und Weise dem autoritären Führerprinzip diente und Filme zur Aufrüs- tung sowie mit Durchhalteparolen instrumentalisierte - auch wenn auf den Leinwänden gesungen und getanzt, auch wenn der ein oder andere historische Stoff verfilmt wurde. „Die Wahrheit stirbt zuerst“ im Krieg, eine Feststellung, die so aktuell ist, wie die russische Invasion derzeit in der Ukraine.
Wahrheit und Lüge, sie sind im Film nahe beieinander, auch in den Filmen des ersten Jahrzehnts der „Burg-Lichtspiele“. Die sogenannten Heimatfilme suggerierten die heile Welt inmitten einer Trümmerlandschaft, Operettenfilme in blühenden Landschaften lenkten ab vom verlorenen Krieg, verlorenen Seelen und verlorenen Mitmenschen. Nur wenige Filme setzten sich mit der jüngeren Vergangenheit auseinander, nur folgende seien hier genannt: „Die Mörder sind unter uns“ und „Rosen für den Staatsanwalt“ von Wolfgang Staudte oder „Berliner Ballade“ von Robert A. Stemmle und „Die Brücke“ von Bernhard Wicki. Auf seine eigene Art und Weise zwischen Satire und Selbst- kritik macht das „Film ohne Titel“, den ich zum heutigen Anlass auswählen durfte, weil er sich mit dem Filmemachen beschäftigt, 1947 entstanden ist und auch weil er noch in einer originalen 35mm-Version existiert.
Einen der klügsten deutschen Nachkriegsfilme zum Jubiläum
Ein Regisseur, ein Filmautor und ein Schauspieler suchen nach einem komödiantischen und zeitnahen Drehbuchstoff. Der Zufall konfrontiert sie mit dem Schicksal eines Paares, das jeder der drei Beteiligten auf seine ganz persönliche Weise dramaturgisch variiert. Von Helmut Käutner konzipiert und von Rudolf Jugert mit bescheidenen Produktionsmitteln, aber mit hochkarätiger Besetzung wie Hildegard Knef und Hans Söhnker inszeniert, ist der Film ein ironisches Spiegelbild des Lebensgefühls. „Der Film hat Tempo und Zeitkolorit“, schreibt die Kritik auf dem „Filmportal“, er zeige die ganze Misere des Krieges, das abenteuerliche Überleben nach der Befreiung. Und das Filmmagazin Cinema nennt ihn „einen der klügsten deutschen Nachkriegsfilme: Amüsant und visionär nimmt er Kinoklischees aufs Korn, die wenig später Deutschlands Lein- wände beherrschen sollten“.
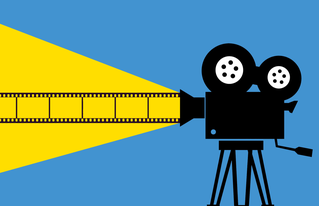
Zuvor sehen Sie eine ausgestorbene Spezies des Kinos, eine Wochenschau. „Welt im Film“ Nummer 96 stammt vom 28. März 1947 und könnte am 3. April des gleichen Jahres hier in den Burg-Lichtspielen gezeigt worden sein, als sich der Vorhang zur ersten Aufführung in diesem Hause öffnete. Wie die Geschichte weiterging, das wissen ja einige von Ihnen, da sie diese zum Teil mitgestaltet haben. Aus den Burg-Lichtspielen wurde 1986 ein Kommunales Kino und das Filmtheater von Grund auf saniert. Die Kommune wird Träger einer Kultureinrichtung, so wie Ginsheim-Gustavsburg sich eine Musikschule leistet und Bischofsheim eine Bücherei. Hervorgegangen ist das Komki aus dem Filmring der Volkshochschule Mainspitze, der 1974 im Capitol der Nachbargemeinde seinen ersten Film zeigte. Ich war als junger Student von Anfang an mit dabei und hatte zumeist das Vergnügen, einführende Worte für ein interessiertes Publikum sprechen zu dürfen. Aber das feiern wir zu gegebener Zeit, zum 50-jährigen im Jahre 2024.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Vergnügen im Kino!
Burg-Lichtspiele
Darmstädter Landstraße 62
65462 Ginsheim-Gustavsburg
Telefon 06134 5576815
